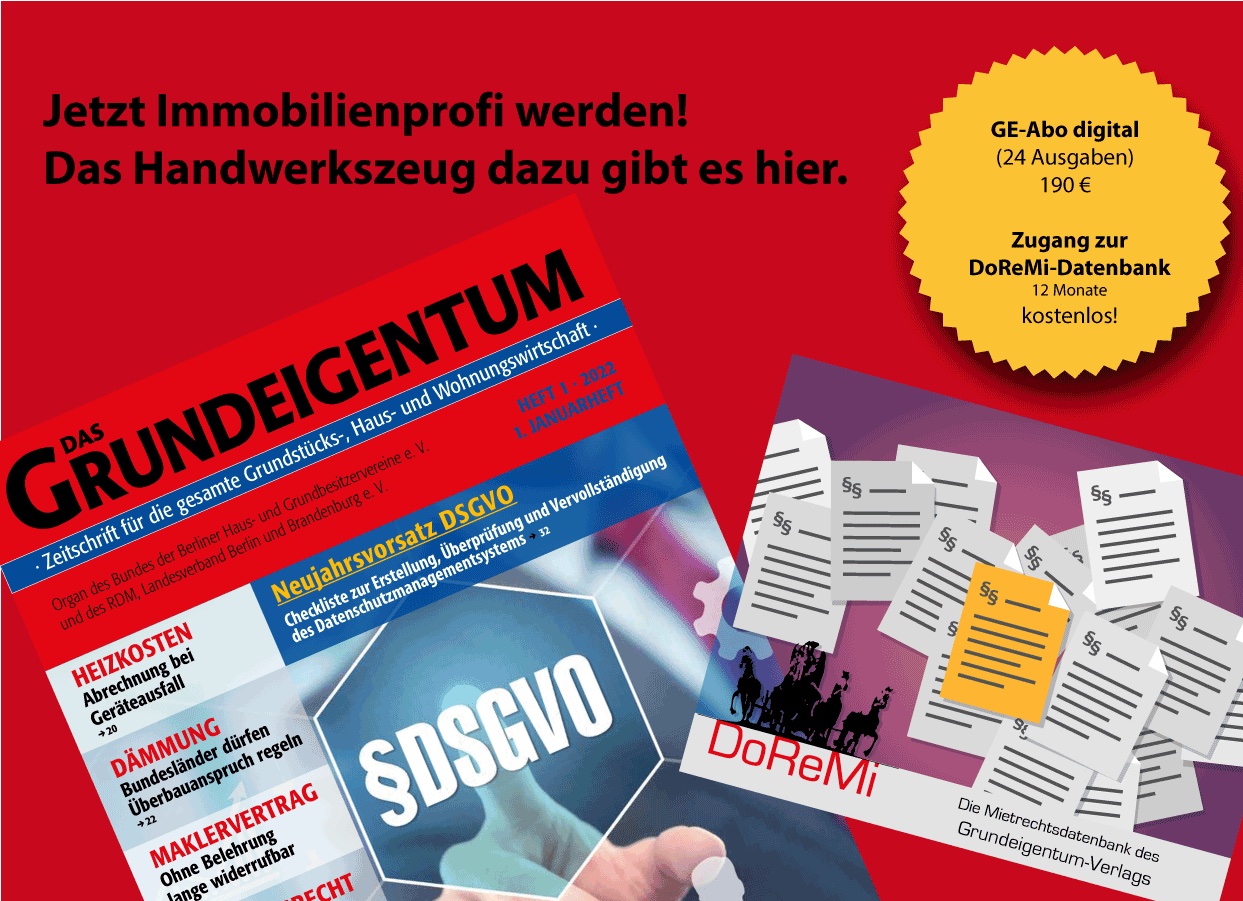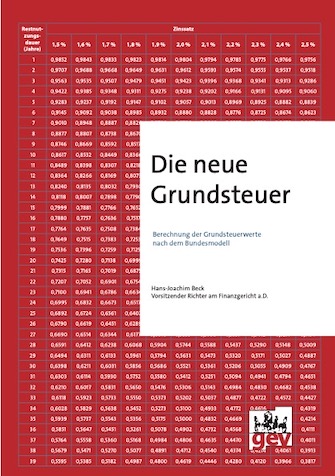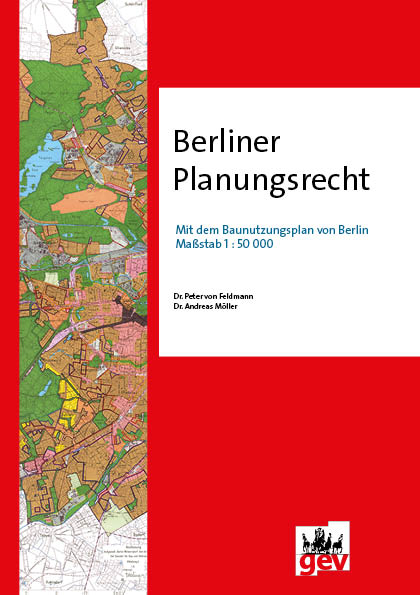News → Kurz notiert
Kellerfeuchte im Altbau kein Kündigungsgrund
Früher im Mauerwerk geduldet und sogar gewollt
02.01.2025 (GE 22/2024, S. 1128) Feuchtigkeit in einem Keller eines im Jahre 1896 errichteten Hauses ist in der Regel kein wichtiger Grund, der für sich allein eine fristlose Kündigung des Mietvertrages durch den Mieter gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB rechtfertigt.
Der Fall: Der Kläger verlangt von den Beklagten Zahlung rückständiger Mieten. Unter § 22 Abs. 6 Nr. 2 des Mietvertrages vereinbarten die Parteien:
„Der Mieter trägt selbst dafür Sorge, dass die von ihm im Mieterkeller gelagerten Gegenstände nicht durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden können. Der Vermieter weist darauf hin, dass solche Schäden nicht durch die Gebäude- bzw. Haftpflichtversicherung getragen werden.“
Im Wohnungsübergabeprotokoll wurde hinsichtlich der „Beschaffenheit“ des Kellers vermerkt, dass dieser „in Ordnung“ sei. Später reklamierten die Beklagten, dass der Keller stark durchfeuchtet und praktisch nicht nutzbar sei. Sie forderten Trockenlegung, kündigten schließlich fristlos und zahlten keine Miete mehr. Die Zahlungsklage des Klägers hatte Erfolg.
Das Urteil: Dass der Keller trocken sein musste, hätten die Mietparteien nicht vereinbart, weshalb nur die Einhaltung der maßgeblichen technischen Normen geschuldet sei. Dabei sei nach der Verkehrsanschauung grundsätzlich der bei der Errichtung des Gebäudes – hier das Jahr 1896 – geltende Maßstab anzulegen.
Unstreitig sei keine Horizontalsperre und keine Außenabdichtung der Kellerwände vorhanden, was jedoch im Einklang mit den im Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebäudes maßgeblichen Normen stehe. 1896 habe noch keine gesetzliche Verpflichtung für solche Maßnahmen bestanden, demgemäß sei das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Kellerbereich ein allgemein üblicher Bauzustand gewesen. Selbst noch im 19. Jahrhundert sei ein gewisser Anteil an Feuchtigkeit im Kellermauerwerk geduldet bzw. gewollt gewesen, damit eingelagertes Gemüse, Obst und Kartoffeln möglichst lange haltbar blieben.
Das Fehlen einer Horizontal- und/oder Vertikalsperre im Kellerbereich begründet damit hier schon keinen Mangel der Mietsache. Zudem habe das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass die Beklagten bereits bei Abschluss des Mietvertrages wussten, dass der mit der Wohnung vermietete Keller feucht ist.
Das Wohnungsübergabeprotokoll sei erst nach Wohnungsbesichtigung angefertigt worden. Bei der Wohnungsbesichtigung sei auch der Keller von einem der Beklagten in Augenschein genommen worden. Außerdem hätten die Beklagten nach eigener Aussage bei der Besichtigung einen modrigen Geruch wahrgenommen. Wohl auch nur aus diesem Grunde hätten den Parteien ausdrücklich vereinbart, dass die Beklagten selbst dafür Sorge zu tragen hätten, dass die von ihnen im Mieterkeller gelagerten Gegenstände nicht durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Kenne jedoch der Mieter bei Vertragsschluss den vermeintlichen „Mangel“ der Mietsache und nähme er sie in diesem Zustand an, begebe er sich ohne Vorbehalt seiner Rechte.
Soweit die Beklagten nunmehr die Feuchtigkeitsbildungen im Keller rügten, fehlten im Übrigen aber auch jegliche näheren Angaben zu Art, Umfang und Ausmaß. Die Angabe, dass die Nutzbarkeit des Kellers aufgrund der Feuchtigkeit derart eingeschränkt sei, dass die Nutzung des Kellers zur Lagerung und Unterstellung von Hausrat und Möbeln nicht geeignet sei, erlaube noch keine Beurteilung der sich daraus ergebenden tatsächlichen Beeinträchtigung. Dass der Keller aber z. B. ungeeignet sei , um dort Fahrräder und/oder Werkzeug unterzustellen, behaupteten die Beklagten nicht.
Die Beklagten hätten hier aufgrund der Kenntnis des vermeintlichen „Mangels“ bei Vertragsschluss dann auch nicht fristlos kündigen dürfen.
Das AG verneinte auch eine zur Kündigung berechtigende Gesundheitsgefährdung. Eine Gesundheitsgefährdung müsse insofern erheblich sein. Eine gewisse Feuchtigkeitsbildung in den Kellerräumen eines alten Hauses bedeute noch nicht eine Gesundheitsgefährdung etwaiger Mieter der Wohnungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des gesamten Mietgebrauchs und ein Mieterrecht zur fristlosen Kündigung wegen Feuchtigkeitserscheinungen komme aber nur dann in Betracht, wenn die Nutzung der Wohnung im Ganzen hierdurch beeinträchtigt sei; Feuchtigkeit allein nur im Keller reiche nicht. Etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen – bei einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit darf der Mieter immer fristlos kündigen – hätten die Beklagten nicht behauptet.
Den Wortlaut finden Sie in GE 2024, Seite 1151 und in unserer Datenbank.
„Der Mieter trägt selbst dafür Sorge, dass die von ihm im Mieterkeller gelagerten Gegenstände nicht durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden können. Der Vermieter weist darauf hin, dass solche Schäden nicht durch die Gebäude- bzw. Haftpflichtversicherung getragen werden.“
Im Wohnungsübergabeprotokoll wurde hinsichtlich der „Beschaffenheit“ des Kellers vermerkt, dass dieser „in Ordnung“ sei. Später reklamierten die Beklagten, dass der Keller stark durchfeuchtet und praktisch nicht nutzbar sei. Sie forderten Trockenlegung, kündigten schließlich fristlos und zahlten keine Miete mehr. Die Zahlungsklage des Klägers hatte Erfolg.
Das Urteil: Dass der Keller trocken sein musste, hätten die Mietparteien nicht vereinbart, weshalb nur die Einhaltung der maßgeblichen technischen Normen geschuldet sei. Dabei sei nach der Verkehrsanschauung grundsätzlich der bei der Errichtung des Gebäudes – hier das Jahr 1896 – geltende Maßstab anzulegen.
Unstreitig sei keine Horizontalsperre und keine Außenabdichtung der Kellerwände vorhanden, was jedoch im Einklang mit den im Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebäudes maßgeblichen Normen stehe. 1896 habe noch keine gesetzliche Verpflichtung für solche Maßnahmen bestanden, demgemäß sei das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Kellerbereich ein allgemein üblicher Bauzustand gewesen. Selbst noch im 19. Jahrhundert sei ein gewisser Anteil an Feuchtigkeit im Kellermauerwerk geduldet bzw. gewollt gewesen, damit eingelagertes Gemüse, Obst und Kartoffeln möglichst lange haltbar blieben.
Das Fehlen einer Horizontal- und/oder Vertikalsperre im Kellerbereich begründet damit hier schon keinen Mangel der Mietsache. Zudem habe das Gericht die Überzeugung gewonnen, dass die Beklagten bereits bei Abschluss des Mietvertrages wussten, dass der mit der Wohnung vermietete Keller feucht ist.
Das Wohnungsübergabeprotokoll sei erst nach Wohnungsbesichtigung angefertigt worden. Bei der Wohnungsbesichtigung sei auch der Keller von einem der Beklagten in Augenschein genommen worden. Außerdem hätten die Beklagten nach eigener Aussage bei der Besichtigung einen modrigen Geruch wahrgenommen. Wohl auch nur aus diesem Grunde hätten den Parteien ausdrücklich vereinbart, dass die Beklagten selbst dafür Sorge zu tragen hätten, dass die von ihnen im Mieterkeller gelagerten Gegenstände nicht durch Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Kenne jedoch der Mieter bei Vertragsschluss den vermeintlichen „Mangel“ der Mietsache und nähme er sie in diesem Zustand an, begebe er sich ohne Vorbehalt seiner Rechte.
Soweit die Beklagten nunmehr die Feuchtigkeitsbildungen im Keller rügten, fehlten im Übrigen aber auch jegliche näheren Angaben zu Art, Umfang und Ausmaß. Die Angabe, dass die Nutzbarkeit des Kellers aufgrund der Feuchtigkeit derart eingeschränkt sei, dass die Nutzung des Kellers zur Lagerung und Unterstellung von Hausrat und Möbeln nicht geeignet sei, erlaube noch keine Beurteilung der sich daraus ergebenden tatsächlichen Beeinträchtigung. Dass der Keller aber z. B. ungeeignet sei , um dort Fahrräder und/oder Werkzeug unterzustellen, behaupteten die Beklagten nicht.
Die Beklagten hätten hier aufgrund der Kenntnis des vermeintlichen „Mangels“ bei Vertragsschluss dann auch nicht fristlos kündigen dürfen.
Das AG verneinte auch eine zur Kündigung berechtigende Gesundheitsgefährdung. Eine Gesundheitsgefährdung müsse insofern erheblich sein. Eine gewisse Feuchtigkeitsbildung in den Kellerräumen eines alten Hauses bedeute noch nicht eine Gesundheitsgefährdung etwaiger Mieter der Wohnungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des gesamten Mietgebrauchs und ein Mieterrecht zur fristlosen Kündigung wegen Feuchtigkeitserscheinungen komme aber nur dann in Betracht, wenn die Nutzung der Wohnung im Ganzen hierdurch beeinträchtigt sei; Feuchtigkeit allein nur im Keller reiche nicht. Etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen – bei einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit darf der Mieter immer fristlos kündigen – hätten die Beklagten nicht behauptet.
Den Wortlaut finden Sie in GE 2024, Seite 1151 und in unserer Datenbank.
Links: