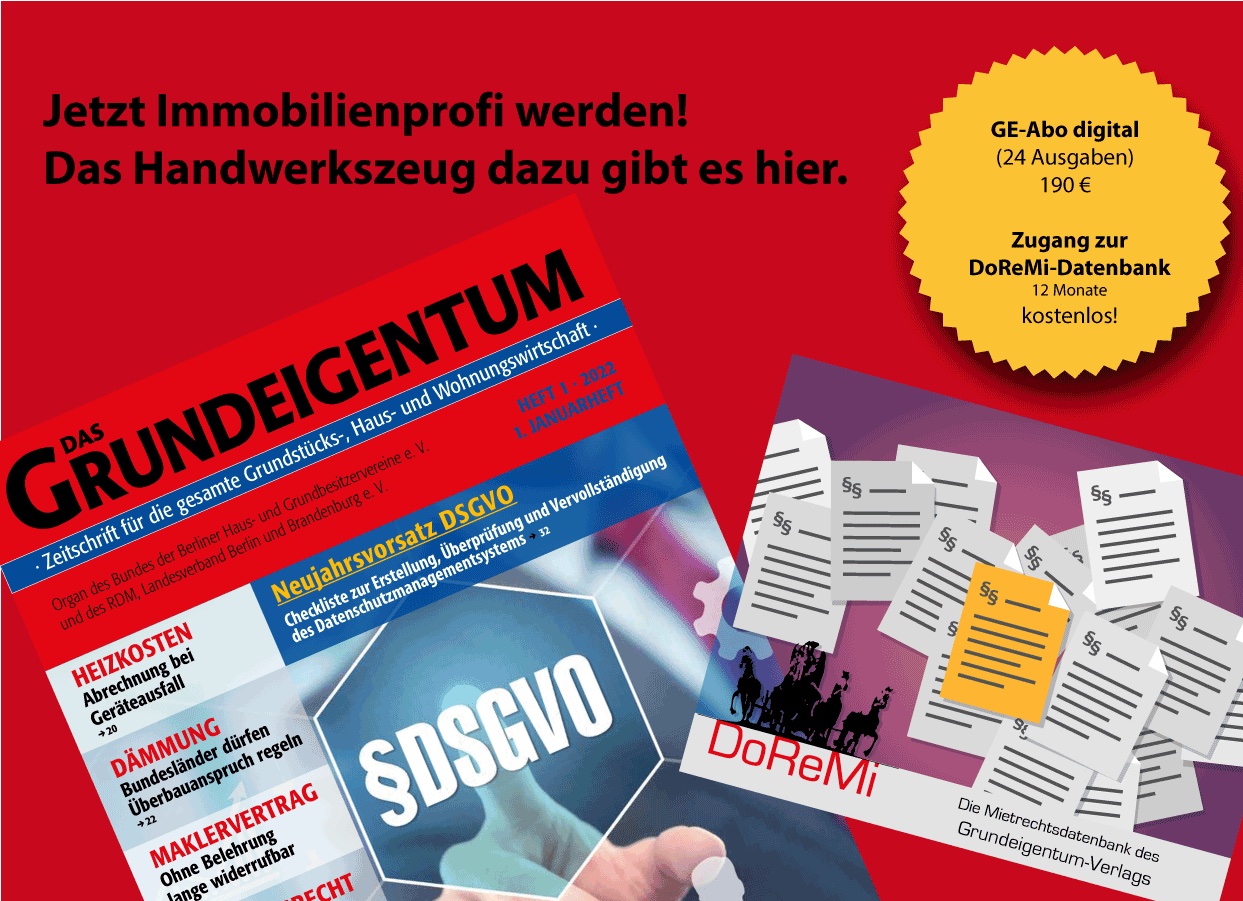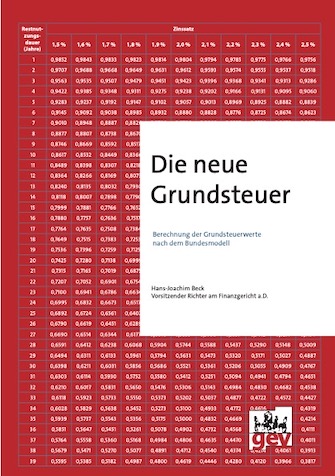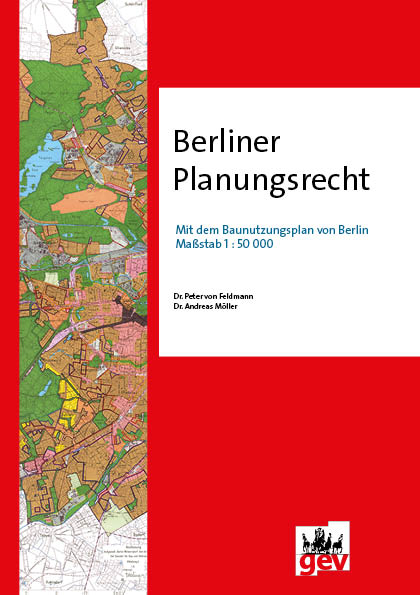Archiv / Suche
Qualifizierter Mietspiegel aus wissenschaftlicher Sicht: Nur im Rahmen einer Vollerhebung möglich?
Neue Studie erscheint im Juni und lässt kein gutes Haar an bisherigen Übersichten
01.07.2015 (GE 11/2015, S. 682) Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und die Universität Regensburg wollen im Rahmen einer im Juni erscheinenden Studie Anforderungen an funktionstüchtige Mietspiegel aus wissenschaftlicher Sicht darlegen und Vorschläge für eine verbesserte Regulierung entwickeln.
Durch die Einführung der Mietpreisbremse werde, so die Wissenschaftler aus Mannheim und Regensburg, der Mietspiegel zum zentralen Steuerungselement des deutschen Wohnungsmarktes und habe unmittelbare Auswirkungen auf Mieter und Vermieter. Konsequenterweise beabsichtige die Bundesregierung eine Novellierung der gesetzlichen Regelungen zum sogenannten qualifizierten Mietspiegel, der zur Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete diene und nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen sei. Die bisherige gesetzliche Regelung benenne zwar die Einhaltung anerkannter wissenschaftlicher Grundsätze als Anforderung, lege jedoch keine gesetzlich bindenden Standards für die konkrete methodische Ausgestaltung der Erstellung qualifizierter Mietspiegel fest.
In einer im Juni erscheinenden Studie des ZEW und der Uni Regensburg seien Anforderungen an funktionstüchtige Mietspiegel aus wissenschaftlicher Sicht dargelegt und Vorschläge für eine verbesserte Regulierung entwickelt worden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entscheidung des AG Charlottenburg, dass der Berliner Mietspiegel nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden sei, möchten ZEW und die Uni Regensburg bereits vorab auf zentrale Ergebnisse der Studie hinweisen.
Danach erfüllten die meisten als „qualifiziert“ ausgewiesenen Mietspiegel nicht abschließend übliche wissenschaftliche Anforderungen an Transparenz in Datenerhebung, Datenaufarbeitung und Datenverarbeitung sowie Offenlegung der Berechnungsergebnisse. Für eine transparente Vergleichsmietenregelung wäre dies jedoch dringend erforderlich.
Von Mieterverbänden werde derzeit angeregt, den gesetzlich zulässigen Bemessungszeitraum für die zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete herangezogenen Mietentgelte von derzeit vier auf zehn Jahre auszudehnen. Eine solche Verbreiterung der Datenbasis sei „durchaus zulässig“ und „entspreche üblichen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Preisfindung auf Wohnungsmärkten“. Eine unzureichende statistische Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte, auf die sich die Mietentgelte jeweils beziehen, wäre jedoch ein eindeutiger Verstoß gegen grundlegende wissenschaftliche Prinzipien, da ein wesentlicher, die Miethöhe bestimmender Faktor außer Acht gelassen würde. Der Datenumfang, auf dessen Grundlage viele als „qualifiziert“ ausgewiesene Mietspiegel erstellt wurden, sei für eine repräsentative Stichprobe zu gering, teilen die Verfasser der Studie schon jetzt mit. Zudem bestünden vielfach Bedenken bezüglich systematischer Verzerrungen bei der Erhebung, etwa aufgrund selektiven Antwortverhaltens bei Mieter- und Vermieterbefragungen. Aufgrund des starken staatlichen Markteingriffs durch die Mietpreisbremse und der damit verbundenen Auswirkungen auf Mieter und Vermieter erscheine eine Erstellung qualifizierter Mietspiegel „auf Basis von Informationen über die Grundgesamtheit aller örtlichen Mietwohnungen geboten“. Dies wäre durch eine rechtlich bindende Vollerhebung erforderlicher Vermietungsdaten möglich. Auf eine Erfassung von Mieterhöhungen sollte hingegen zukünftig verzichtet werden. Soweit die Mitteilung von ZEW und der Uni Regensburg. Fairerweise wird man die Studie abwarten müssen, um zu erfahren, ob sie wirklich so wenig Erhellendes enthält, wie die Vorabmitteilung vermuten lässt. Wenn man einen qualifizierten Mietspiegel nur auf Basis einer Vollerhebung bekommt, wie die Verfasser meinen, kann man das Instrument gleich vergessen. Eine Vollerhebung – und das auch noch alle zwei Jahre – kann keine Gemeinde bezahlen; dass eine Stichprobe nicht ausreichen soll, hat, soweit ersichtlich, noch niemand vertreten. Warum man die in den letzten zehn Jahren vereinbarten Mieten erfassen und sie jeweils inflationsbereinigen will, statt schlicht – wie bisher – jüngere Mietabschlüsse zu verwenden, ist auch unverständlich vor dem Hintergrund des Vergleichsmietsystems. Das will (und muss aus verfassungsrechtlichen Gründen) doch nur garantieren, dass der Vermieter für seine Wohnung in etwa die Miete bekommt, die andere Vermieter am Ort für ihre vergleichbaren Wohnungen erzielen, wobei extreme Preisspitzen wie -täler ausgeschaltet werden sollen.
In einer im Juni erscheinenden Studie des ZEW und der Uni Regensburg seien Anforderungen an funktionstüchtige Mietspiegel aus wissenschaftlicher Sicht dargelegt und Vorschläge für eine verbesserte Regulierung entwickelt worden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entscheidung des AG Charlottenburg, dass der Berliner Mietspiegel nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden sei, möchten ZEW und die Uni Regensburg bereits vorab auf zentrale Ergebnisse der Studie hinweisen.
Danach erfüllten die meisten als „qualifiziert“ ausgewiesenen Mietspiegel nicht abschließend übliche wissenschaftliche Anforderungen an Transparenz in Datenerhebung, Datenaufarbeitung und Datenverarbeitung sowie Offenlegung der Berechnungsergebnisse. Für eine transparente Vergleichsmietenregelung wäre dies jedoch dringend erforderlich.
Von Mieterverbänden werde derzeit angeregt, den gesetzlich zulässigen Bemessungszeitraum für die zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete herangezogenen Mietentgelte von derzeit vier auf zehn Jahre auszudehnen. Eine solche Verbreiterung der Datenbasis sei „durchaus zulässig“ und „entspreche üblichen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Preisfindung auf Wohnungsmärkten“. Eine unzureichende statistische Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte, auf die sich die Mietentgelte jeweils beziehen, wäre jedoch ein eindeutiger Verstoß gegen grundlegende wissenschaftliche Prinzipien, da ein wesentlicher, die Miethöhe bestimmender Faktor außer Acht gelassen würde. Der Datenumfang, auf dessen Grundlage viele als „qualifiziert“ ausgewiesene Mietspiegel erstellt wurden, sei für eine repräsentative Stichprobe zu gering, teilen die Verfasser der Studie schon jetzt mit. Zudem bestünden vielfach Bedenken bezüglich systematischer Verzerrungen bei der Erhebung, etwa aufgrund selektiven Antwortverhaltens bei Mieter- und Vermieterbefragungen. Aufgrund des starken staatlichen Markteingriffs durch die Mietpreisbremse und der damit verbundenen Auswirkungen auf Mieter und Vermieter erscheine eine Erstellung qualifizierter Mietspiegel „auf Basis von Informationen über die Grundgesamtheit aller örtlichen Mietwohnungen geboten“. Dies wäre durch eine rechtlich bindende Vollerhebung erforderlicher Vermietungsdaten möglich. Auf eine Erfassung von Mieterhöhungen sollte hingegen zukünftig verzichtet werden. Soweit die Mitteilung von ZEW und der Uni Regensburg. Fairerweise wird man die Studie abwarten müssen, um zu erfahren, ob sie wirklich so wenig Erhellendes enthält, wie die Vorabmitteilung vermuten lässt. Wenn man einen qualifizierten Mietspiegel nur auf Basis einer Vollerhebung bekommt, wie die Verfasser meinen, kann man das Instrument gleich vergessen. Eine Vollerhebung – und das auch noch alle zwei Jahre – kann keine Gemeinde bezahlen; dass eine Stichprobe nicht ausreichen soll, hat, soweit ersichtlich, noch niemand vertreten. Warum man die in den letzten zehn Jahren vereinbarten Mieten erfassen und sie jeweils inflationsbereinigen will, statt schlicht – wie bisher – jüngere Mietabschlüsse zu verwenden, ist auch unverständlich vor dem Hintergrund des Vergleichsmietsystems. Das will (und muss aus verfassungsrechtlichen Gründen) doch nur garantieren, dass der Vermieter für seine Wohnung in etwa die Miete bekommt, die andere Vermieter am Ort für ihre vergleichbaren Wohnungen erzielen, wobei extreme Preisspitzen wie -täler ausgeschaltet werden sollen.