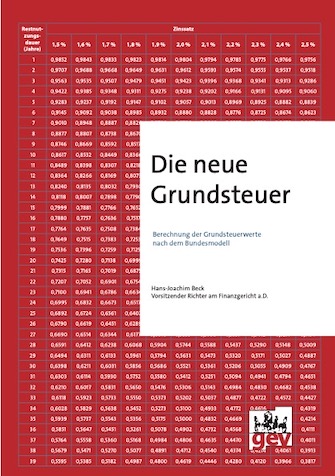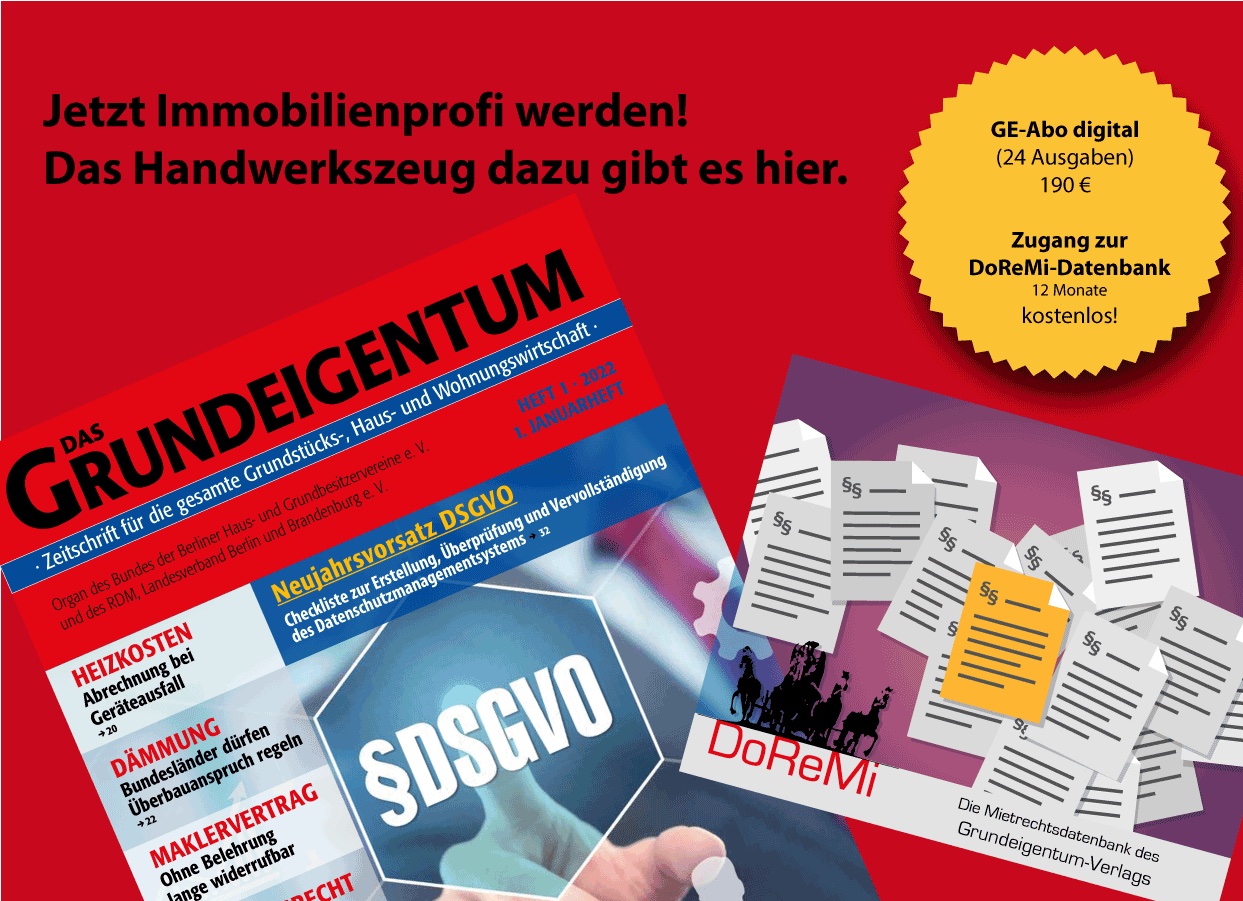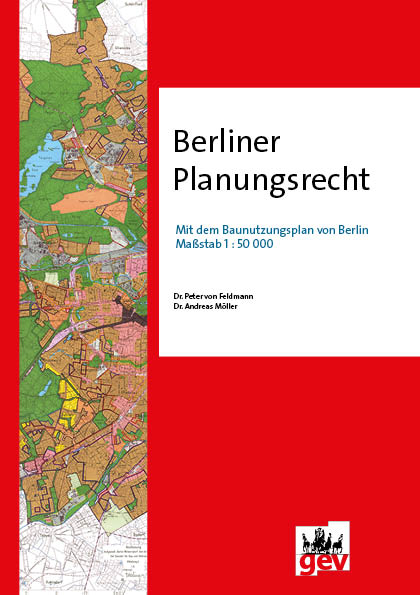News → Kurz notiert
Was kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nach einem „schwarzen“ Ausbau gegen wen tun?
Voreigentümer baute vor 20 Jahren einen Spitzboden in eine Dachterrasse um
18.08.2025 (GE 13/2025, S. 624) Jede bauliche Veränderung muss, ist nichts anderes vereinbart, für ihre Rechtmäßigkeit durch eine Vereinbarung oder einen Beschluss gestattet und dadurch legitimiert werden. Fehlt es an dieser Gestattung, liegt ein „Schwarzbau“ vor. Gegen diesen kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer vorgehen. Sie muss aber den richtigen Weg gehen. Dabei ist die Zeit im Auge zu behalten.
Der Fall: Wohnungseigentümer Y baute vor 20 Jahren einen im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Spitzboden in eine Dachterrasse um. Um eine Gestattung bat er nicht. Später veräußerte er sein Wohnungseigentum an Wohnungseigentümer Z.
Im Jahr 2023 weisen die Wohnungseigentümer die Verwaltung an, diesen Z aufzufordern, die Dachterrasse zurückzubauen, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und die Dachterrasse abzusperren. Sollte die Aufforderung fruchtlos bleiben, soll Z entsprechend verklagt werden. Ferner wird die Verwaltung unter der Bedingung, dass das Ganze nicht mehr als 5.000 € kostet, ermächtigt, nach Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung zeitnah einen Auftrag zur Umsetzung der Maßnahmen zu vergeben. Über die Frage, wer die Kosten letztlich zu tragen hat, soll später beschlossen werden.
Wohnungseigentümer Z geht gegen diese Beschlüsse erfolgreich vor dem AG vor. Die dagegen gerichtete Berufung scheitert. Gegen die nicht erfolgte Zulassung der Revision durch das LG wendet sich die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer mit einer Nichtzulassungsbeschwerde.
Das Urteil: Ohne Erfolg! Der BGH meint, die Nichtzulassungsbeschwerde sei unzulässig. Der Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übersteige im Fall nicht 20.000 €.
Anmerkung: Das Interesse der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer an einem Rechtsmittel richtet sich gem. § 3 ZPO nach den Umständen des Einzelfalls. Zur Frage, wie sie durch die Dachterrasse beeinträchtigt wird, hatte die Gemeinschaft indes keine Angaben gemacht. Dann aber sind 0 € anzusetzen, wenn man auch nicht schätzen kann. Daneben kam es auf die Kosten für den Rückbau an (= 5.000 €) und die „Vorklärung“, den Umlageschlüssel für die Kosten der Maßnahmen später zu bestimmen (= 1.000 €). In der Addition erreicht das nicht den „Erwachsenheitsbetrag“ von 20.000 €.
Im Ergebnis nichts Neues und ein Einzelfall. Wir berichten ihn daher aus einem anderen Grunde. Nämlich: Was ist bei einem Schwarzbau zu tun? Die Antwort lautet: Es ist zu unterscheiden! Man kann den „Bauherrn“ und seinen Sondernachfolger in den Blick nehmen.
Der „Bauherr“ war Y. Er war „Handlungsstörer“. Bis zum Ablauf der dreijährigen Verjährung ab Kenntnis (bzw. im Einzelfall ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren) konnte er von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auf einen Rückbau in Anspruch genommen werden. Denn für seine Maßnahmen gab es keine Gestattung. Für die Frage, ob der Schwarzbau der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer „bekannt“ ist, kommt es grundsätzlich auf die Kenntnis der Verwaltung als Vertretung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer an. Gibt es keine Verwaltung, ist es schwieriger. Dann vertreten die Wohnungseigentümer die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Es könnte aber die Kenntnis bereits eines Wohnungseigentümers schaden. Y hätte (im heutigen Recht) in erster Instanz im Übrigen eine auf § 20 Abs. 3 WEG gestützte Widerklage erheben können (BGH GE 2025, 447 Rn. 26 ff.). Voraussichtlich allerdings erfolglos, da wohl kein Wohnungseigentümer ohne Gestattung nach § 20 Abs. 3 WEG einen Anspruch haben kann, einen im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Spitzboden in eine Dachterrasse umzubauen.
Der Sondernachfolger ist Z. Er ist bloßer Zustandsstörer. Die Pflicht, eine widerrechtliche bauliche Veränderung zurückzubauen, wird grundsätzlich nicht auf ihn übergegangen sein (siehe nur Hügel/Elzer, 4. Aufl. 2025, WEG § 20 Rn. 165). Der Zustandsstörer ist aber verpflichtet, jedenfalls die Beseitigung der Störung durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu dulden (der entsprechende Anspruch kann nicht verjähren). Neben einer Duldung kann von ihm im Einzelfall außerdem Unterlassung des Gebrauchs und der Nutzung und ggf. die Zahlung einer Nutzungsentschädigung verlangt werden. Ausnahmsweise soll ein Sondernachfolger sogar zur Beseitigung verpflichtet sein. Das soll dann der Fall sein, wenn ihm die Störung „zurechenbar“ ist (BGH GE 2010, 699 Rn. 14). Dies soll voraussetzen, dass der Sondernachfolger nicht nur tatsächlich und rechtlich in der Lage ist, die Störung zu beseitigen, sondern zudem, dass die Störung bei der gebotenen wertenden Betrachtung durch seinen maßgebenden Willen zumindest „aufrechterhalten“ wird (BGH GE 2010, 699 Rn. 14). So könnte es im Fall liegen.
Da im Fall Ansprüche gegen Wohnungseigentümer Y verjährt waren, hätte die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer jedenfalls beschließen können, die Dachterrasse selbst und auf eigene Kosten zurückzubauen. Wohnungseigentümer Z hätte das dulden müssen. Das muss er im Übrigen immer noch! Denn die Rechtskraft der Entscheidung, dass er nicht zurückbauen muss, ändert daran nichts.
Den Wortlaut finden Sie in GE 2025, Seite 662 und in unserer Datenbank.
Im Jahr 2023 weisen die Wohnungseigentümer die Verwaltung an, diesen Z aufzufordern, die Dachterrasse zurückzubauen, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und die Dachterrasse abzusperren. Sollte die Aufforderung fruchtlos bleiben, soll Z entsprechend verklagt werden. Ferner wird die Verwaltung unter der Bedingung, dass das Ganze nicht mehr als 5.000 € kostet, ermächtigt, nach Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung zeitnah einen Auftrag zur Umsetzung der Maßnahmen zu vergeben. Über die Frage, wer die Kosten letztlich zu tragen hat, soll später beschlossen werden.
Wohnungseigentümer Z geht gegen diese Beschlüsse erfolgreich vor dem AG vor. Die dagegen gerichtete Berufung scheitert. Gegen die nicht erfolgte Zulassung der Revision durch das LG wendet sich die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer mit einer Nichtzulassungsbeschwerde.
Das Urteil: Ohne Erfolg! Der BGH meint, die Nichtzulassungsbeschwerde sei unzulässig. Der Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer übersteige im Fall nicht 20.000 €.
Anmerkung: Das Interesse der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer an einem Rechtsmittel richtet sich gem. § 3 ZPO nach den Umständen des Einzelfalls. Zur Frage, wie sie durch die Dachterrasse beeinträchtigt wird, hatte die Gemeinschaft indes keine Angaben gemacht. Dann aber sind 0 € anzusetzen, wenn man auch nicht schätzen kann. Daneben kam es auf die Kosten für den Rückbau an (= 5.000 €) und die „Vorklärung“, den Umlageschlüssel für die Kosten der Maßnahmen später zu bestimmen (= 1.000 €). In der Addition erreicht das nicht den „Erwachsenheitsbetrag“ von 20.000 €.
Im Ergebnis nichts Neues und ein Einzelfall. Wir berichten ihn daher aus einem anderen Grunde. Nämlich: Was ist bei einem Schwarzbau zu tun? Die Antwort lautet: Es ist zu unterscheiden! Man kann den „Bauherrn“ und seinen Sondernachfolger in den Blick nehmen.
Der „Bauherr“ war Y. Er war „Handlungsstörer“. Bis zum Ablauf der dreijährigen Verjährung ab Kenntnis (bzw. im Einzelfall ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren) konnte er von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auf einen Rückbau in Anspruch genommen werden. Denn für seine Maßnahmen gab es keine Gestattung. Für die Frage, ob der Schwarzbau der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer „bekannt“ ist, kommt es grundsätzlich auf die Kenntnis der Verwaltung als Vertretung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer an. Gibt es keine Verwaltung, ist es schwieriger. Dann vertreten die Wohnungseigentümer die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Es könnte aber die Kenntnis bereits eines Wohnungseigentümers schaden. Y hätte (im heutigen Recht) in erster Instanz im Übrigen eine auf § 20 Abs. 3 WEG gestützte Widerklage erheben können (BGH GE 2025, 447 Rn. 26 ff.). Voraussichtlich allerdings erfolglos, da wohl kein Wohnungseigentümer ohne Gestattung nach § 20 Abs. 3 WEG einen Anspruch haben kann, einen im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Spitzboden in eine Dachterrasse umzubauen.
Der Sondernachfolger ist Z. Er ist bloßer Zustandsstörer. Die Pflicht, eine widerrechtliche bauliche Veränderung zurückzubauen, wird grundsätzlich nicht auf ihn übergegangen sein (siehe nur Hügel/Elzer, 4. Aufl. 2025, WEG § 20 Rn. 165). Der Zustandsstörer ist aber verpflichtet, jedenfalls die Beseitigung der Störung durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu dulden (der entsprechende Anspruch kann nicht verjähren). Neben einer Duldung kann von ihm im Einzelfall außerdem Unterlassung des Gebrauchs und der Nutzung und ggf. die Zahlung einer Nutzungsentschädigung verlangt werden. Ausnahmsweise soll ein Sondernachfolger sogar zur Beseitigung verpflichtet sein. Das soll dann der Fall sein, wenn ihm die Störung „zurechenbar“ ist (BGH GE 2010, 699 Rn. 14). Dies soll voraussetzen, dass der Sondernachfolger nicht nur tatsächlich und rechtlich in der Lage ist, die Störung zu beseitigen, sondern zudem, dass die Störung bei der gebotenen wertenden Betrachtung durch seinen maßgebenden Willen zumindest „aufrechterhalten“ wird (BGH GE 2010, 699 Rn. 14). So könnte es im Fall liegen.
Da im Fall Ansprüche gegen Wohnungseigentümer Y verjährt waren, hätte die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer jedenfalls beschließen können, die Dachterrasse selbst und auf eigene Kosten zurückzubauen. Wohnungseigentümer Z hätte das dulden müssen. Das muss er im Übrigen immer noch! Denn die Rechtskraft der Entscheidung, dass er nicht zurückbauen muss, ändert daran nichts.
Den Wortlaut finden Sie in GE 2025, Seite 662 und in unserer Datenbank.
Autor: VRiKG Dr. Oliver Elzer
Links: