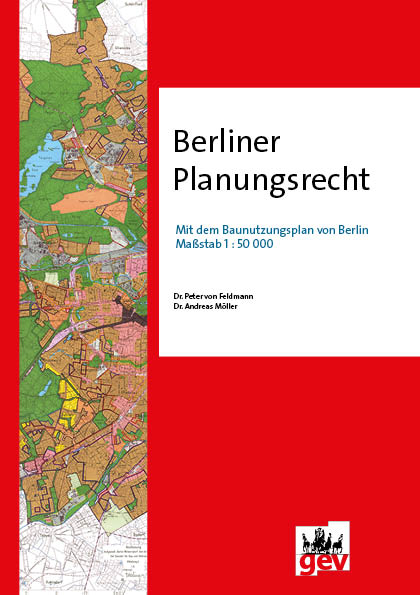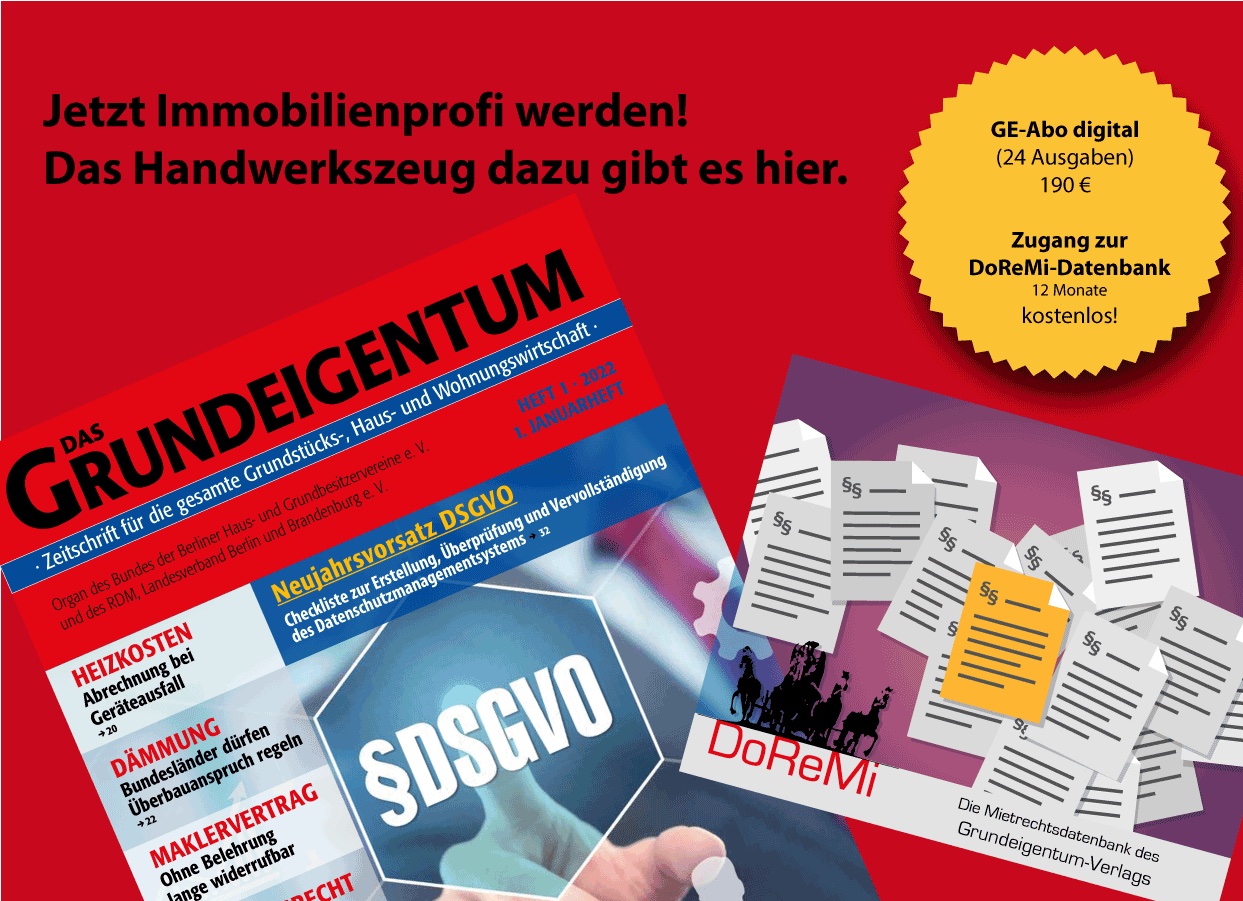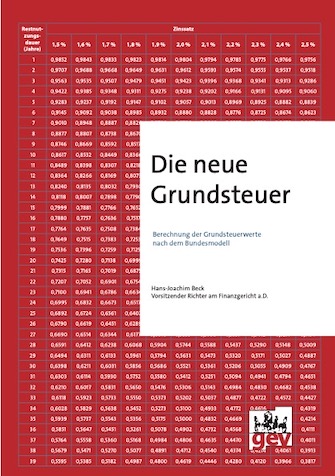News → Kurz notiert
Kosten der „Berliner Räumung“ für vor dem 1. Mai 2013 begonnene Räumungsverfahren
In Altfällen muss man sich das Geld noch in einem ordentlichen Verfahren holen
08.05.2015 (GE 7/2015, S. 417) Nach dem Modell der „Berliner Räumung“ kann der Vermieter bei der Vollstreckung eines Räumungstitels den Auftrag an den Gerichtsvollzieher darauf beschränken, die Wohnung zu öffnen und den Mieter aus der Wohnung zu setzen. Wohnung ausräumen, Sachen des Mieters unterstellen und ggf. verwerten, kann man preiswerter bewerkstelligen alsdurchBeauftragungdesGerichtsvollziehers.AberauchdanndeckendieVerwertungserlöse die Kosten oft nicht. Man kann diese Kosten, um sie nicht in einem gesonderten Verfahren hereinholen zu müssen, aber als Kosten der Zwangsvollstreckung festsetzen lassen, allerdings nicht für vor dem 1. Mai 2013 in Gang gesetzte Räumungen. In diesen Altfällen muss man sich das Geld im ordentlichen Verfahren holen.
Der Fall: Der Mieter (Schuldner) wurde 2012 zur Räumung und Herausgabe verurteilt. Weil er nicht freiwillig räumte, wurde der Vermieter (Gläubiger) vom Gerichtsvollzieher in den Besitz der Wohnung eingewiesen. Der Vermieter ließ die Wohnung unter Berufung auf sein Vermieterpfandrecht von einer Privatfirma räumen und das Pfandgut über einen freien Versteigerer versteigern. Die ihm von der Privatfirma nach Abzug des Versteigerungserlöses entstandenen Kosten will der Vermieter als weitere Kosten der Zwangsvollstreckung gegen den Mieter festgesetzt haben. Das AG Mitte lehnte den Antrag ab, das LG Berlin gab der Beschwerde nicht statt, ließ aber Rechtsbeschwerde zum BGH zu. Auch dort hatte der Vermieter keinen Erfolg.
Zum Hintergrund: Durch das am 1. Mai 2013 in Kraft getretene Mietrechtsänderungsgesetz vom 11. März 2013 wurde das schon zuvor in der Rechtsprechung anerkannte „Berliner Modell“ zur Räumungsvollstreckung gesetzlich näher geregelt (durch Einfügung von § 885 a in die Zivilprozessordnung [ZPO]). Seit dem 1. Mai 2013 kann der Vermieter (Gläubiger) den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher darauf beschränken, ihm den Besitz an den Räumen zu verschaffen. Die noch in der Wohnung befindlichen und dem Vermieterpfandrecht unterliegenden Sachen des Mieters kann der Vermieter – vereinfacht gesagt – wegschaffen und verwerten. Die Kosten, die dem Vermieter durch die Wegschaffung, Verwahrung, Vernichtung oder Verwertung der Sachen des Mieters entstehen, sind Kosten der Zwangsvollstreckung (§ 885 a Abs. 7 ZPO) – aber das gilt nur für nach dem 30. April 2013 begonnene Räumungen. Für Räumungen davor gilt das nicht.
Der Beschluss: Bei den Kosten der Räumung durch eine Privatfirma handele es sich nicht um Kosten der Zwangsvollstreckung – jedenfalls nicht bei Räumungen, mit denen vor dem 1. Mai 2013 begonnen wurde.
Im Streitfall erfolgte die Räumung der Wohnung vom 14. bis 16. November 2012 und damit vor Inkrafttreten des § 885 a ZPO am 1. Mai 2013. Eine Anwendung der neuen Vorschrift auf bei Inkrafttreten des Gesetzes schon laufende Verfahren lehnt der BGH mit einer Reihe von grundsätzlichen Überlegungen ab. Auch der amtlichen Begründung des Mietrechtsänderungsgesetzes 2013 sei nicht zu entnehmen, dass mit § 885 a Abs. 7 ZPO lediglich bereits geltendes (Richter-) Recht (= die von den Gerichten anerkannte„Berliner Räumung“) in Gesetzesform gegossen werden sollte. Dass der Vermieter ein privates Unternehmen beauftragt hatte, das Objekt zu räumen, und dass er das Pfandgut durch einen freien Versteigerer öffentlich hatte versteigern lassen, hätte im Grundsatz einer Festsetzung als Zwangsvollstreckungskosten nicht entgegengestanden. Eine Kostenfestsetzung könne unter Umständen auch für Kosten erfolgen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag und nicht auf dem Handeln eines staatlichen Vollstreckungsorgans (Gerichtsvollzieher) beruhten. Beim (alten) „Berliner Modell“ wird der auf Räumung und Herausgabe einer bestimmten Wohnung gerichtete Titel von vornherein nur beschränkt vollstreckt, indem der Gläubiger den Gerichtsvollzieher allein damit beauftragt, ihn in den Besitz der Wohnung einzuweisen. Sinn dieser Vorgehensweise war es, hohe Transport- und Lagerkosten zu vermeiden und damit den Kostenvorschuss für die Vollstreckung zu reduzieren. Würden aber – bis 1. Mai 2013 – wesentliche Teile der Räumung privat durchgesetzt, könnten die dabei entstehenden Kosten nur aufgrund einer besonderen gesetzlichen Anordnung den Kosten der Zwangsvollstreckung gleichgestellt werden. Daran habe es bis zum 1. Mai 2013 gefehlt.
Gründe der Prozesswirtschaftlichkeit, die den Gesetzgeber zur Einfügung des § 885 a Abs. 7 ZPO bewogen haben, könnten für die Zeit vor dem 1. Mai 2013 für sich allein kein anderes Ergebnis rechtfertigen. Vor Inkrafttreten von § 885 a Abs. 7 ZPO habe kein Anhaltspunkt dafür bestanden, diese Räumungskosten entgegen dem Zweck des „Berliner Modells“ und dem Wortsinn als Kosten der Zwangsvollstreckung gemäß § 788 Abs. 1 ZPO anzusehen.
(Den Wortlaut des Urteils finden Sie in GE 2015, Seite 450 und in unserer Datenbank)
Zum Hintergrund: Durch das am 1. Mai 2013 in Kraft getretene Mietrechtsänderungsgesetz vom 11. März 2013 wurde das schon zuvor in der Rechtsprechung anerkannte „Berliner Modell“ zur Räumungsvollstreckung gesetzlich näher geregelt (durch Einfügung von § 885 a in die Zivilprozessordnung [ZPO]). Seit dem 1. Mai 2013 kann der Vermieter (Gläubiger) den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher darauf beschränken, ihm den Besitz an den Räumen zu verschaffen. Die noch in der Wohnung befindlichen und dem Vermieterpfandrecht unterliegenden Sachen des Mieters kann der Vermieter – vereinfacht gesagt – wegschaffen und verwerten. Die Kosten, die dem Vermieter durch die Wegschaffung, Verwahrung, Vernichtung oder Verwertung der Sachen des Mieters entstehen, sind Kosten der Zwangsvollstreckung (§ 885 a Abs. 7 ZPO) – aber das gilt nur für nach dem 30. April 2013 begonnene Räumungen. Für Räumungen davor gilt das nicht.
Der Beschluss: Bei den Kosten der Räumung durch eine Privatfirma handele es sich nicht um Kosten der Zwangsvollstreckung – jedenfalls nicht bei Räumungen, mit denen vor dem 1. Mai 2013 begonnen wurde.
Im Streitfall erfolgte die Räumung der Wohnung vom 14. bis 16. November 2012 und damit vor Inkrafttreten des § 885 a ZPO am 1. Mai 2013. Eine Anwendung der neuen Vorschrift auf bei Inkrafttreten des Gesetzes schon laufende Verfahren lehnt der BGH mit einer Reihe von grundsätzlichen Überlegungen ab. Auch der amtlichen Begründung des Mietrechtsänderungsgesetzes 2013 sei nicht zu entnehmen, dass mit § 885 a Abs. 7 ZPO lediglich bereits geltendes (Richter-) Recht (= die von den Gerichten anerkannte„Berliner Räumung“) in Gesetzesform gegossen werden sollte. Dass der Vermieter ein privates Unternehmen beauftragt hatte, das Objekt zu räumen, und dass er das Pfandgut durch einen freien Versteigerer öffentlich hatte versteigern lassen, hätte im Grundsatz einer Festsetzung als Zwangsvollstreckungskosten nicht entgegengestanden. Eine Kostenfestsetzung könne unter Umständen auch für Kosten erfolgen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag und nicht auf dem Handeln eines staatlichen Vollstreckungsorgans (Gerichtsvollzieher) beruhten. Beim (alten) „Berliner Modell“ wird der auf Räumung und Herausgabe einer bestimmten Wohnung gerichtete Titel von vornherein nur beschränkt vollstreckt, indem der Gläubiger den Gerichtsvollzieher allein damit beauftragt, ihn in den Besitz der Wohnung einzuweisen. Sinn dieser Vorgehensweise war es, hohe Transport- und Lagerkosten zu vermeiden und damit den Kostenvorschuss für die Vollstreckung zu reduzieren. Würden aber – bis 1. Mai 2013 – wesentliche Teile der Räumung privat durchgesetzt, könnten die dabei entstehenden Kosten nur aufgrund einer besonderen gesetzlichen Anordnung den Kosten der Zwangsvollstreckung gleichgestellt werden. Daran habe es bis zum 1. Mai 2013 gefehlt.
Gründe der Prozesswirtschaftlichkeit, die den Gesetzgeber zur Einfügung des § 885 a Abs. 7 ZPO bewogen haben, könnten für die Zeit vor dem 1. Mai 2013 für sich allein kein anderes Ergebnis rechtfertigen. Vor Inkrafttreten von § 885 a Abs. 7 ZPO habe kein Anhaltspunkt dafür bestanden, diese Räumungskosten entgegen dem Zweck des „Berliner Modells“ und dem Wortsinn als Kosten der Zwangsvollstreckung gemäß § 788 Abs. 1 ZPO anzusehen.
(Den Wortlaut des Urteils finden Sie in GE 2015, Seite 450 und in unserer Datenbank)
Links: