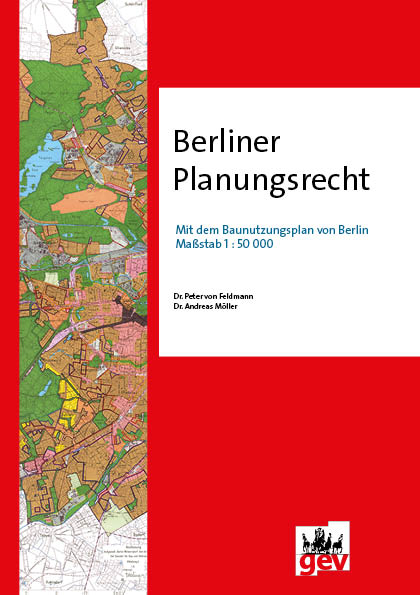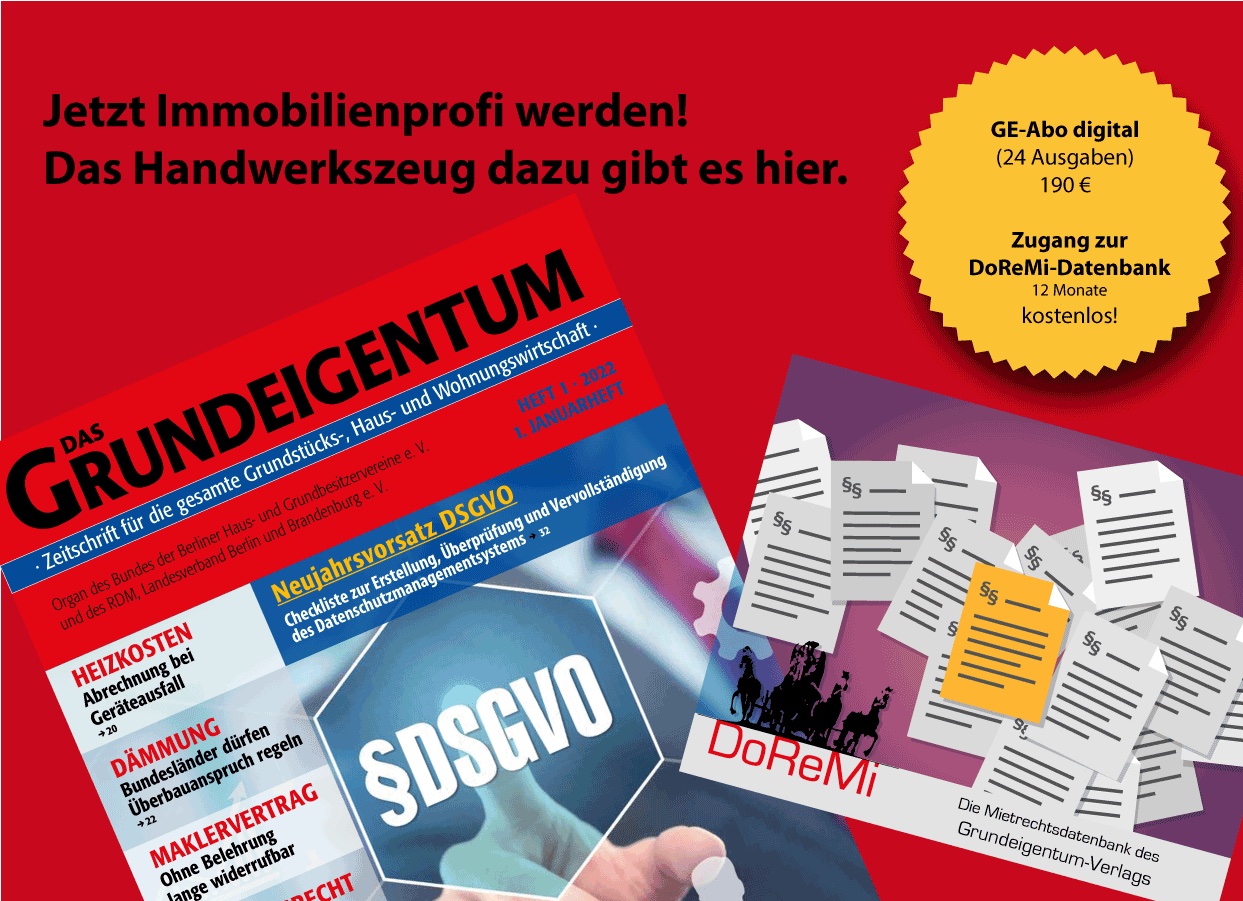Archiv / Suche
Austausch des Bodenbelags in Eigentumswohnung
Nur Anspruch auf zeitkongruenten Schallschutz
22.06.2015 (GE 10/2015, S. 633) Wird der Bodenbelag in einer Eigentumswohnung (hier: Teppichboden) durch einen anderen (hier: Parkett) ersetzt, richtet sich der zu gewährende Schallschutz grundsätzlich nach der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes geltenden Ausgabe der DIN 4109; ein höheres einzuhaltendes Schallschutzniveau kann sich zwar aus der Gemeinschaftsordnung ergeben, nicht aber aus einem besonderen Gepräge der Wohnanlage. Was den letzten Punkt betrifft, gibt der BGH insoweit seine bisherige Rechtsprechung auf.
Der Fall: Die Parteien im zugrunde liegenden Verfahren sind Wohnungserbbauberechtigte. Die Beklagten erwarben das über der Wohnung der Kläger in einem Anfang der 70er Jahre errichteten Hochhaus liegende Appartement im Jahr 2006 und ließen den vorhandenen Teppichboden durch Parkett ersetzen. Dagegen wenden sich die Kläger mit der Begründung, der Trittschall habe sich durch den Wechsel des Bodenbelags erhöht. Das Amtsgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt, in ihrer Wohnung anstelle des Parketts Teppichboden oder einen in der Trittschalldämmung gleichwertigen Bodenbelag zu verlegen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen.
Das Urteil: Der BGH bestätigte die Klageabweisung. Rechtlicher Maßstab für die zwischen den Eigentümern hinsichtlich des Schallschutzes bestehenden Pflichten ist § 14 Nr. 1 WEG. Danach ist u. a. jeder Eigentümer verpflichtet, die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instand zu halten und von diesen sowie von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise Gebrauch zu machen, dass dadurch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst.
Die Kläger werden durch den Wechsel des Bodenbelags nicht im Sinne dieser Norm nachteilig betroffen. Wird ein vorhandener Bodenbelag durch einen anderen ersetzt und dabei – wie hier – nicht in den unter dem Belag befindlichen Estrich und die Geschossdecke eingegriffen, so sind grundsätzlich die Schallschutzwerte einzuhalten, die sich aus der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes geltenden Ausgabe der DIN 4109 ergeben. Diese werden gewahrt. Ein höheres Schallschutzniveau kann sich aus der Gemeinschaftsordnung ergeben. Diese aber enthält keine solchen Vorgaben. Dass die im Zuge der Errichtung des Hochhauses erstellte Baubeschreibung und der ursprüngliche Verkaufsprospekt eine Ausstattung der Appartements mit Teppichböden vorsahen, hat der BGH als unerheblich angesehen.
In einem früheren Urteil aus 2012 vertrat der BGH noch die Auffassung, ein höheres Schallschutzniveau könne sich auch aus dem besonderen Gepräge der Wohnanlage – beispielsweise der bei der Errichtung vorhandenen Ausstattung oder dem Wohnumfeld – ergeben. Daran hält der BGH ausdrücklich nicht mehr fest. Die Feststellung der Erstausstattung sei aufwendig, und es gebe keinen Grund, das Schallschutzniveau an ihr auszurichten. Zudem müsse der Schallschutz in erster Linie durch die im Gemeinschaftseigentum stehenden Bauteile gewährleistet werden.
Anmerkung: Der BGH vollzieht teilweise eine Kehrtwende zu seinem Urteil vom 1. Juni 2012 (GE 2012, 967). Es geht um den sensiblen Gesichtspunkt, dass bei der dem Zeitgeschmack entsprechenden Ersetzung des Teppichbodens in der Wohnung durch Parkett oder Fliesen die darunter liegende Wohnung durch die Trittgeräusche stärker als vorher beeinträchtigt wird. Im Urteil vom 1. Juni 2012 hat der BGH noch zugelassen, dass sich der schutzbedürftige untere Eigentümer darauf berufen kann, dass nach dem besonderen Gepräge der Wohnanlage ein stärkerer Trittschallschutz zu gewährleisten ist, als er sich aus der bei Errichtung der Wohnanlage geltenden Ausgabe der DIN 4109 ergibt. Davon rückt der BGH nunmehr ab. Er führt aus, dass der Bodenbelag in der Wohnung grundsätzlich Sondereigentum ist und vom Eigentümer nach Belieben verändert werden darf, während der Schallschutz durch das unter dem Sondereigentum am Bodenbelag liegende gemeinschaftliche Eigentum zu gewährleisten ist, wobei die im Zeitpunkt der Errichtung der Wohnanlage geltenden Schallschutznormen einzuhalten sind, aber auch nicht mehr.
Auch kann es nur auf die Angaben in der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung zu einem höheren Schallschutzniveau ankommen, weil nur diese (durch Bezugnahme) im Wohnungsgrundbuch eingetragen und für spätere Erwerber ersichtlich sind. Umgekehrt ausgedrückt: Die Baubeschreibung für die Wohnanlage, auch wenn sie in sämtlichen Kaufverträgen enthalten ist, steht einer Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung nicht gleich, solange sie nicht in die Teilungserklärung aufgenommen worden ist. In der Baubeschreibung geht es nur um die vom Bauträger gegenüber den ersten Erwerbern geschuldeten Leistungen, nicht aber um den Trittschallstandard für alle Zukunft. Im Hinblick auf die Ausstattung des Sondereigentums bei der Errichtung sind Abweichungen im Bodenbelag aufgrund von Sonderwünschen gängige Praxis. Selbst Ersterwerber werden häufig keine zuverlässige Kenntnis von der Gestaltung des Bodenbelags der weiteren Wohnungen haben. Auch die Baubeschreibung bietet keine Gewähr dafür, dass die in ihr enthaltenen Anforderungen an den Schallschutz in die Tat umgesetzt worden sind, wenn der Bauträger vertraglich höhere Schallschutzwerte als die der DIN 4109 schuldet. Ebenso wenig lässt das Wohnumfeld keine tragfähigen Rückschlüsse auf den bei der Errichtung erzielten Schallschutz zu, abgesehen davon, dass sich das Wohnumfeld im Laufe der Jahre verändern kann. Ergänzend macht der BGH Ausführungen für den Fall, dass die Geräusche besonders lästig werden. Auch das ist jedoch unschädlich, weil sich das Schallschutzniveau nicht nach der Lästigkeit der Geräusche richtet. Wird es eingehalten, kann der geltend gemachte Anspruch auf Auswechslung des Bodenbelags nicht auf die Herbeiführung besonders lästiger Geräusche gestützt werden. Nur deren Unterlassung kann verlangt werden. Dies setzt wiederum eine übermäßige oder ungewöhnliche Wohnnutzung voraus und scheidet bei solchen Geräuschen aus, welche die übliche Nutzung einer Wohnung verursachen. Prozesse auf Verbesserung des Bodenbelags in darüber liegenden Wohnungen wegen der späteren Auswechselung des Bodens und der Verschlechterung des Schallschutzes sind also künftig erheblich erschwert.
(Den Wortlaut des Urteils finden Sie in GE 2015, Seite 667 und in unserer Datenbank)
Das Urteil: Der BGH bestätigte die Klageabweisung. Rechtlicher Maßstab für die zwischen den Eigentümern hinsichtlich des Schallschutzes bestehenden Pflichten ist § 14 Nr. 1 WEG. Danach ist u. a. jeder Eigentümer verpflichtet, die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instand zu halten und von diesen sowie von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise Gebrauch zu machen, dass dadurch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst.
Die Kläger werden durch den Wechsel des Bodenbelags nicht im Sinne dieser Norm nachteilig betroffen. Wird ein vorhandener Bodenbelag durch einen anderen ersetzt und dabei – wie hier – nicht in den unter dem Belag befindlichen Estrich und die Geschossdecke eingegriffen, so sind grundsätzlich die Schallschutzwerte einzuhalten, die sich aus der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes geltenden Ausgabe der DIN 4109 ergeben. Diese werden gewahrt. Ein höheres Schallschutzniveau kann sich aus der Gemeinschaftsordnung ergeben. Diese aber enthält keine solchen Vorgaben. Dass die im Zuge der Errichtung des Hochhauses erstellte Baubeschreibung und der ursprüngliche Verkaufsprospekt eine Ausstattung der Appartements mit Teppichböden vorsahen, hat der BGH als unerheblich angesehen.
In einem früheren Urteil aus 2012 vertrat der BGH noch die Auffassung, ein höheres Schallschutzniveau könne sich auch aus dem besonderen Gepräge der Wohnanlage – beispielsweise der bei der Errichtung vorhandenen Ausstattung oder dem Wohnumfeld – ergeben. Daran hält der BGH ausdrücklich nicht mehr fest. Die Feststellung der Erstausstattung sei aufwendig, und es gebe keinen Grund, das Schallschutzniveau an ihr auszurichten. Zudem müsse der Schallschutz in erster Linie durch die im Gemeinschaftseigentum stehenden Bauteile gewährleistet werden.
Anmerkung: Der BGH vollzieht teilweise eine Kehrtwende zu seinem Urteil vom 1. Juni 2012 (GE 2012, 967). Es geht um den sensiblen Gesichtspunkt, dass bei der dem Zeitgeschmack entsprechenden Ersetzung des Teppichbodens in der Wohnung durch Parkett oder Fliesen die darunter liegende Wohnung durch die Trittgeräusche stärker als vorher beeinträchtigt wird. Im Urteil vom 1. Juni 2012 hat der BGH noch zugelassen, dass sich der schutzbedürftige untere Eigentümer darauf berufen kann, dass nach dem besonderen Gepräge der Wohnanlage ein stärkerer Trittschallschutz zu gewährleisten ist, als er sich aus der bei Errichtung der Wohnanlage geltenden Ausgabe der DIN 4109 ergibt. Davon rückt der BGH nunmehr ab. Er führt aus, dass der Bodenbelag in der Wohnung grundsätzlich Sondereigentum ist und vom Eigentümer nach Belieben verändert werden darf, während der Schallschutz durch das unter dem Sondereigentum am Bodenbelag liegende gemeinschaftliche Eigentum zu gewährleisten ist, wobei die im Zeitpunkt der Errichtung der Wohnanlage geltenden Schallschutznormen einzuhalten sind, aber auch nicht mehr.
Auch kann es nur auf die Angaben in der Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung zu einem höheren Schallschutzniveau ankommen, weil nur diese (durch Bezugnahme) im Wohnungsgrundbuch eingetragen und für spätere Erwerber ersichtlich sind. Umgekehrt ausgedrückt: Die Baubeschreibung für die Wohnanlage, auch wenn sie in sämtlichen Kaufverträgen enthalten ist, steht einer Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung nicht gleich, solange sie nicht in die Teilungserklärung aufgenommen worden ist. In der Baubeschreibung geht es nur um die vom Bauträger gegenüber den ersten Erwerbern geschuldeten Leistungen, nicht aber um den Trittschallstandard für alle Zukunft. Im Hinblick auf die Ausstattung des Sondereigentums bei der Errichtung sind Abweichungen im Bodenbelag aufgrund von Sonderwünschen gängige Praxis. Selbst Ersterwerber werden häufig keine zuverlässige Kenntnis von der Gestaltung des Bodenbelags der weiteren Wohnungen haben. Auch die Baubeschreibung bietet keine Gewähr dafür, dass die in ihr enthaltenen Anforderungen an den Schallschutz in die Tat umgesetzt worden sind, wenn der Bauträger vertraglich höhere Schallschutzwerte als die der DIN 4109 schuldet. Ebenso wenig lässt das Wohnumfeld keine tragfähigen Rückschlüsse auf den bei der Errichtung erzielten Schallschutz zu, abgesehen davon, dass sich das Wohnumfeld im Laufe der Jahre verändern kann. Ergänzend macht der BGH Ausführungen für den Fall, dass die Geräusche besonders lästig werden. Auch das ist jedoch unschädlich, weil sich das Schallschutzniveau nicht nach der Lästigkeit der Geräusche richtet. Wird es eingehalten, kann der geltend gemachte Anspruch auf Auswechslung des Bodenbelags nicht auf die Herbeiführung besonders lästiger Geräusche gestützt werden. Nur deren Unterlassung kann verlangt werden. Dies setzt wiederum eine übermäßige oder ungewöhnliche Wohnnutzung voraus und scheidet bei solchen Geräuschen aus, welche die übliche Nutzung einer Wohnung verursachen. Prozesse auf Verbesserung des Bodenbelags in darüber liegenden Wohnungen wegen der späteren Auswechselung des Bodens und der Verschlechterung des Schallschutzes sind also künftig erheblich erschwert.
(Den Wortlaut des Urteils finden Sie in GE 2015, Seite 667 und in unserer Datenbank)
Autor: VRiKG a. D. RA Dr. Lothar Briesemeister AKD Dittert, Südhoff & Partner
Links: